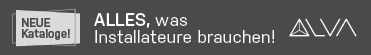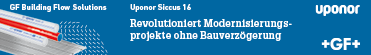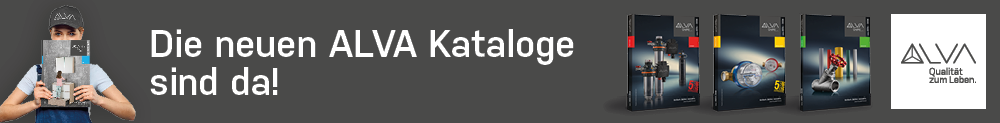Climadesign
Hilfreiche Planungsmethode
Doppelfassaden entwickeln sich zum zentralen Bestandteil innovativer Gebäude. Richtig geplant, decken sie einen grossen Teil der HLK-Funktionen mit ab.
Allerdings sind die bisher üblichen Planungsprozesse für die Verflechtung von Architektur, Aussenklima, Raumklima und flexibler Flächennutzung eher ungeeignet. Die Projektgruppe >Climadesign< an der TU München hat dafür einen Planungsansatz mit mehreren Fachdisziplinen entwickelt.
Den aktuellen Architekturentwürfen liegen mehrheitlich Energiekonzepte zu Grunde, bei denen die konventionelle Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik eine eher untergeordnete Rolle spielt. Begünstigt wird diese Entwicklung durch innovative Fassaden, funktionale Gläser und kombinierte Sonnenschutz-/Tageslichtsysteme, die den Anteil an klassischer Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik weiter zurückdrängen. Hinzu kommt der Wunsch der Investoren nach einer maximaler Flexibilität von Liegenschaften mit der Konsequenz, dass immer häufiger dezentrale, fassadenorientierte Lüftungselemente mit Heiz-/Kühlfunktion eingesetzt werden. Parallel dazu wird der Begriff des Wohlbefindens heute weiter gefasst.
Die Einhaltung normgerechter Größen für Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftwechsel und Luftströmung im Raum werden immer weniger als alleiniger Maßstab für eine individuell gefühlte Behaglichkeit betrachtet. Auch eine ganz auf Energieeinsparung ausgerichtete Gebäudetechnik gebe heute keine Garantie mehr für die Akzeptanz eines Investors
und für das Wohlbefinden der Nutzer im Gebäude, so Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen, Mitbegründer von Climadesign. Es sei unerlässlich, den Kontakt zur Außenwelt mit einzuplanen, wobei die reine Sichtbeziehung nicht ausreiche, sondern auch Aspekte wie Geräusche, Gerüche oder das Wettergeschehen berücksichtigt werden müssten.
Oftmals nehme der Nutzer, so der Klimaexperte, temporäre Unbehaglichkeiten in Kauf, um den Kontakt nach Außen herzustellen, beispielsweise durch das Öffnen eines Fensters. Auch bei hohem Automatisierungsgrad der gebäudetechnischen Anlagen müsse eine individuelle Bestimmung des Raumklimas durch den jeweiligen Nutzer möglich sein. Wichtig sei eine sicht- und fühlbare Rückkoppelung der Funktionsfähigkeit von technischen Systemen. Nur so könne das Gefühl des „Ausgeliefertseins“ an die Gebäudetechnik vermieden werden.
Mit trägen Speichermassen zu gutmütigen Gebäuden
Die Abkehr von Klimaanlagen klassischen Zuschnitts dürfe allerdings nicht mit einer Aufweichung des thermischen Komforts verbunden werden. Hausladen plädiert für die strikte Einhaltung der oberen Behaglichkeitsgrenze bei 26°C. Allgemein bestehe heute aufgrund des Trends zu klimatisierten Automobilen ein höherer Anspruch an das Raumklima. Den Schlüssel zu klimatisch angenehmen Gebäuden sieht Hausladen in der Grundkonditionierung über thermisch aktivierte Speichermassen mittels regenerativer Heiz-/Kühlsysteme und der individuellen Nachkonditionierung durch den jeweiligen Nutzer über schnell regelbare Heiz-/Kühlelemente in Form von Heiz-/Kühldecken oder dezentralen,
fassadenorientierten Funktionselementen. Bei solcherart «gutmütigen» und «robusten» Gebäuden sei ein großer Anteil an Behaglichkeit bereits funktional im Gebäude integriert. Durch weitere Speichereinbauten, beispielsweise von Energie speichernden, leichten Raumtrennwänden nach dem Latentspeicherprinzip, könnte die thermische Trägheit von Gebäuden nochmals gesteigert und gleichzeitig der Regelungsaufwand gesenkt werden.
Noch nicht ausgereift: Doppelfassaden…
Bei der Frage, welches Lüftungskonzept die größere Akzeptanz findet, scheinen alle Arten „natürlicher“ Verfahren bei der Gunst der Nutzer und damit auch der Architekten vorn zu liegen. Prof. Hausladen ist davon überzeugt, dass während etwa zwei Drittel des Jahres die Außentemperatur eine behagliche Fensterlüftung zulässt. Bei hohem Außenlärmpegel sowie bei hohen Gebäuden mit entsprechenden Windlasten könne das Problem öffenbarer Fenster mit Hilfe von Doppelfassaden gelöst werden. Allerdings gäbe es im Bereich der Fassaden noch zu viele Negativbeispiele, insbesondere wegen der hohen solaren Wärmelasten, die bislang nur durch den Einbau konventioneller Raumklimaanlagen beherrscht werden konnten. Sowohl bei Doppelfassaden als auch bei dezentralen Fassadenlüftungsgeräten sieht er noch erheblichen Entwicklungsbedarf.
Energetisch und architektonisch interessant sei die Doppelfassade bei der Sanierung vorhandener Bürogebäude. Bei Neubauten sei dagegen eher ein Trend zurück zur funktionalen Einfachfassade festzustellen. Wichtigste Aufgabe bei allen Fassadenbauarten sei die Reduzierung der solaren Einstrahlung mit Hilfe gut funktionierender Sonnenschutzsysteme. Auch müsse über eine Verminderung des transparenten Anteils der Fassade nachgedacht werden.
... und Fassadenlüftungen
Grosse Hoffnungen werden jetzt in Fassaden mit niedrigem U-Wert gesetzt, beispielsweise in solche mit Vakuumisolierpaneelen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur noch 0,004 W/mK liegt die Hightech-Wärmedämmung um den Faktor 8 bis 10 unter dem Wert sonst üblicher Dämmstoffe. Hersteller solcher Dämmsysteme bzw. von Fassaden mit Vakuumpaneelen signalisierten auf den zurückliegenden Baumessen eine kurzfristige Marktreaktion. Auch Gläser mit integriertem Sonnenschutz und schaltbaren Beschichtungen stehen kurz vor der Marktreife.
Was in diesem, derzeit sehr innovativen Marktsegment noch fehlt, sind Konzepte, die natürliche und mechanische Lüftungen miteinander verbinden, so Hausladen. Wegen der gewünschten Flexibilität in der Raumnutzung sind dezentrale Lüftungssysteme hier im Vorteil. Ideal ist die Kombination von Geräten mit minimalen Heiz-/Kühlleistungen in Verbindung mit Bauteiltemperiersystemen.
Problemstellungen: TGA-Fachplaner sind schlecht vorbereitet
Aus Sicht von Prof. Hausladen sind die meisten Ingenieure der Versorgungstechnik bislang nur unzureichend auf die Problemstellungen aktueller Architekturtrends vorbereitet. Die bisherige Ingenieurausbildung sei weit gehend auf technische Systeme und weniger auf bauliche Zusammenhänge ausgerichtet. Wichtig seien vor allen Dingen Kenntnisse der thermodynamischen und strömungstechnischen Zusammenhänge in einem Gebäude. Statische Berechnungen von Kühllast und Wärmebedarf gehören in modernen Bürogebäuden ohnehin der Vergangenheit an. Aus der Sicht von Hausladen müsste die Zusammenarbeit von TGA-Fachplaner und Architekt im Idealfall noch während der Vorplanung beginnen. Oft könne man z. ß. durch die Drehung eines Gebäudes die bauklimatischen Rahmenbedingungen entscheidend verbessern und so beispielsweise eine Minimierung der solaren Einstrahlung im Sommer oder die Nutzung der Windanströmung zum Antrieb natürlicher Lüftungskonzepte erreichen.
Interdisziplinäre Projektgruppe
Climadesign ist eine Projektgruppe an der Technischen Universität München, die sich aus mehreren Disziplinen zusammensetzt. Gründungsmitglieder sind Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hausladen, Dipl.-Ing. Michael de Saldanha, Dipl.-Ing. Petra Liedl und Dipl.-Ing. Christina Sager vom Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik. Projektpartner sind außerdem der Lehrstuhl für Thermodynamik mit Schwerpunkt auf der Untersuchung von Luftkollektoren, Brennstoffzellen, Wärmedämmsystemen und Doppelfassaden sowie der Lehrstuhl für Fluidmechanik mit Schwerpunkt auf der Gebäudeaerodynamik.
Innovationen in der Baubranche mit HLK-Rückkoppelung
- Parallel-Ausstell-Fenster (PAF) mit Spaltlüftung (6 mm) parallel zum Blendrahmen (Siegenia)
- Hochwärmegedämmter Fensterladen mit integriertem, selbsttätig wirkendem Solarantrieb (Bayerwald) Smart Window mit variablem g-Wert (Cricursa/Spanien)
- Passivhausfassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion mit U-Wert = 0,75 W/(m2.K) (Rehau AG + Co)
- Systemlösung für die Kontrollierte Natürliche Lüftung (KNL), Klappenstellung nach Raumtemperatur und/oder C02 Konzentration der Raumluft (Window Master)
- Schalldämmlüftung als Teil eines Naturlüftungskonzeptes (Renson/Belgien)
- Lichtlenk- und Verschattungssystem ,dsolettee (Glas Schuler) Fassadendämmung mit Vakuumpaneel U = 0,18 W/(m2.K) (Metallbau Ralf Boetker)
- Fassadensystem mit Vakuumpaneel und integriertem Heiz-/Kühlsystem (Metallbau Ralf Boetker)
- Wasser-Vollflächenabsorber für Pfosten-Riegel-Fassade (Thyssen Schulte Gutmann Bausysteme)
Quelle: Sonderschau «Intelligente Gebäudehüllen»